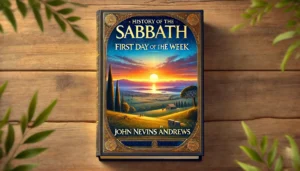Kapitel 14 – Die ersten Zeugen für den Sonntag
Ursprung der Sonntagsfeier als Untersuchungsgegenstand – Widersprüchliche Aussagen von Mosheim und Neander – Die Frage zwischen ihnen dargelegt und die wahren Daten zur Entscheidung dieser Frage – Das Neue Testament bietet keine Unterstützung für Mosheims Aussage – Brief des Barnabas eine Fälschung – Das Zeugnis von Plinius bestimmt nichts in diesem Fall – Der Brief des Ignatius wahrscheinlich gefälscht und jedenfalls interpoliert, soweit er zur Unterstützung des Sonntags herangezogen wird – Entscheidung der Frage
Der erste Tag der Woche wird heute fast universell als christlicher Sabbat begangen. Der Ursprung dieser Institution liegt noch vor uns als Untersuchungsgegenstand. Dieser wird von zwei bedeutenden Kirchenhistorikern vorgestellt, die sich jedoch in ihren Aussagen direkt widersprechen, sodass es eine interessante Frage ist, zu klären, welcher von beiden die Wahrheit sagt. So schreibt Mosheim über das erste Jahrhundert:
„Alle Christen waren sich einig darin, den ersten Tag der Woche, an dem der triumphierende Erlöser von den Toten auferstanden ist, für die feierliche Abhaltung des öffentlichen Gottesdienstes zu reservieren. Dieser fromme Brauch, der auf dem Beispiel der Kirche von Jerusalem beruhte, gründete sich auf die ausdrückliche Anordnung der Apostel, die diesen Tag zu demselben heiligen Zweck weihten, und wurde überall in den christlichen Kirchen beachtet, wie aus den übereinstimmenden Zeugnissen der glaubwürdigsten Schriftsteller hervorgeht.“
Nun lesen wir, was Neander, der bedeutendste der Kirchenhistoriker, über diese apostolische Autorität für die Sonntagsfeier sagt:
„Das Fest des Sonntags war, wie alle anderen Feste, immer nur eine menschliche Verordnung, und es lag den Aposteln fern, in dieser Hinsicht ein göttliches Gebot zu erlassen, fern von ihnen und der frühapostolischen Kirche, die Gesetze des Sabbats auf den Sonntag zu übertragen. Vielleicht hatte gegen Ende des zweiten Jahrhunderts eine solche falsche Anwendung begonnen; denn es scheint, dass man zu jener Zeit das Arbeiten am Sonntag bereits als Sünde betrachtete.“
Wie sollen wir entscheiden, welcher dieser Historiker Recht hat? Keiner von ihnen lebte im apostolischen Zeitalter der Kirche. Mosheim war ein Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts und Neander des neunzehnten. Notwendigerweise müssen sie daher die Fakten aus den Schriften jener Zeit lernen, die uns überliefert sind. Diese enthalten das gesamte Zeugnis, das irgendeinen Anspruch darauf hat, bei der Entscheidung dieses Falles zugelassen zu werden. Diese sind erstens die inspirierten Schriften des Neuen Testaments; zweitens die vermeintlichen Werke solcher Schriftsteller jener Zeit, die den ersten Tag erwähnen sollen, nämlich der Brief des Barnabas; der Brief des Plinius, Gouverneur von Bithynien, an den Kaiser Trajan; und der Brief des Ignatius. Dies sind alle Schriften vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts – und das reicht aus, um Mosheims Aussage abzudecken –, die herangezogen werden können, um auf den ersten Tag der Woche zu verweisen.
Die zu entscheidenden Fragen anhand dieses Zeugnisses sind: Haben die Apostel den Sonntag für den Gottesdienst bestimmt (wie Mosheim behauptet)? Oder zeigt das Beweismaterial, dass das Fest des Sonntags, wie alle anderen Feste, immer nur eine menschliche Verordnung war (wie Neander behauptet)?
Es ist sicher, dass das Neue Testament keine Anordnung des Sonntags für die feierliche Abhaltung des Gottesdienstes enthält. Und es ist ebenso wahr, dass es kein Beispiel der Kirche von Jerusalem gibt, auf dem eine solche Beachtung gegründet werden könnte. Das Neue Testament bietet also keine Unterstützung für Mosheims Aussage.
Die drei Briefe, die uns aus dem apostolischen Zeitalter oder unmittelbar danach überliefert wurden, kommen als nächstes zur Untersuchung. Dies sind alle, die uns aus einer Zeit überliefert sind, die länger ist als die, die Mosheim beschreibt. Er spricht nur vom ersten Jahrhundert; aber wir ziehen alle Schriftsteller dieses Jahrhunderts und des folgenden, vor der Zeit von Justin dem Märtyrer, 140 n. Chr., hinzu, die den ersten Tag der Woche erwähnen sollen. So erhält der Leser alle Daten des Falles. Der Brief des Barnabas spricht wie folgt zur Unterstützung der Sonntagsfeier:
„Zuletzt sagt er zu ihnen: Eure Neumonde und eure Sabbate kann ich nicht ertragen. Überlegt, was er damit meint; die Sabbate, sagt er, die ihr jetzt haltet, sind mir nicht angenehm, sondern jene, die ich gemacht habe; wenn ich mich von allem ausruhe, werde ich den achten Tag beginnen, das ist der Anfang der anderen Welt; aus diesem Grund begehen wir den achten Tag mit Freude, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist und sich seinen Jüngern gezeigt hat, in den Himmel aufgefahren ist.“
Es könnte vernünftigerweise angenommen werden, dass Mosheim großes Vertrauen in dieses Zeugnis setzt, da es von einem Apostel kommt und besser geeignet ist, die Heiligkeit des Sonntags zu unterstützen als alles, was wir zuvor untersucht haben. Doch er räumt offen ein, dass dieser Brief gefälscht ist. So sagt er:
„Der Brief des Barnabas war das Werk eines Juden, der höchstwahrscheinlich in diesem Jahrhundert lebte und dessen geringe Fähigkeiten und abergläubische Anhänglichkeit an jüdische Fabeln, trotz seiner aufrechten Absichten, zeigen, dass er eine ganz andere Person gewesen sein muss als der wahre Barnabas, der Begleiter des heiligen Paulus.“
In einem anderen Werk sagt Mosheim über diesen Brief:
„Was einige vorschlagen, dass er von jenem Barnabas geschrieben wurde, der der Freund und Begleiter des heiligen Paulus war, ist leicht aus dem Brief selbst zu widerlegen; mehrere der Meinungen und Schriftauslegungen, die er enthält, haben so wenig Wahrheit, Würde oder Kraft, dass es unmöglich ist, dass sie jemals aus der Feder eines göttlich unterwiesenen Mannes stammen konnten.“
Neander spricht folgendermaßen über diesen Brief:
„Es ist unmöglich, dass wir diesen Brief jenem Barnabas zuschreiben, der es wert war, der Begleiter der apostolischen Arbeiten des heiligen Paulus zu sein.“
Prof. Stuart trägt ein ähnliches Zeugnis:
„Dass ein Mann mit dem Namen Barnabas diesen Brief schrieb, bezweifle ich nicht; dass der gewählte Begleiter des Paulus ihn schrieb, muss ich mit vielen anderen bezweifeln.“
Dr. Killen, Professor der Kirchengeschichte für die Generalversammlung der presbyterianischen Kirche Irlands, verwendet folgende Worte:
„Die Schrift, die als der Brief des Barnabas bekannt ist, wurde wahrscheinlich um 135 n. Chr. verfasst. Es ist offenbar das Werk eines Konvertiten aus dem Judentum, der besondere Freude an der allegorischen Auslegung der Schrift hatte.“
Prof. Hackett bringt folgendes Zeugnis:
„Der Brief, der noch existiert und bereits im zweiten Jahrhundert als der von Barnabas bekannt war, kann nicht als echt verteidigt werden.“
Herr Milner spricht über den angeblichen Brief des Barnabas folgendermaßen:
„Es ist eine große Ungerechtigkeit gegenüber ihm, den Brief, der seinen Namen trägt, als den seinen zu betrachten.“
Kitto spricht von diesem Werk als „der sogenannte Brief des Barnabas, wahrscheinlich eine Fälschung des zweiten Jahrhunderts.“
In der „Encyclopedia of Religious Knowledge“ wird über den Barnabas des Neuen Testaments gesagt:
„Er konnte nicht der Autor eines Werkes sein, das so voller gezwungener Allegorien, übertriebener und unberechtigter Auslegungen der Schrift, zusammen mit Geschichten über Tiere und solchen Einfällen ist, wie sie den ersten Teil dieses Briefes ausmachen.“
Eusebius, der früheste Kirchenhistoriker, zählt diesen Brief zu den unechten Büchern. So sagt er:
„Unter den unechten Büchern müssen sowohl die Bücher gezählt werden, die als ‚Die Taten des Paulus‘, als auch das sogenannte ‚Der Hirte‘ und ‚Die Offenbarung des Petrus‘ bezeichnet werden. Daneben auch das Buch ‚Der Brief des Barnabas‘ und was als ‚Die Einrichtungen der Apostel‘ bekannt ist.“
Sir Wm. Domville sagt:
„Aber der Brief wurde nicht von Barnabas geschrieben; er war nicht nur unwürdig für ihn – er wäre eine Schande für ihn und, was noch viel wichtiger ist, eine Schande für die christliche Religion, wenn er das Werk eines der autorisierten Lehrer dieser Religion in der Zeit der Apostel gewesen wäre, was das Zeugnis ihrer göttlichen Herkunft ernsthaft beschädigen würde. Da es sich nicht um den Brief von Barnabas handelt, ist das Dokument in Bezug auf die Sabbatfrage nichts weiter als das Zeugnis eines unbekannten Schriftstellers über die Praxis der Sonntagsfeier durch einige Christen einer unbekannten Gemeinde zu einem ungewissen Zeitpunkt der christlichen Ära, ohne ausreichenden Grund zu glauben, dass dieser Zeitraum das erste Jahrhundert war.“
Coleman trägt folgendes Zeugnis bei:
„Der Brief des Barnabas, der den ehrenwerten Namen des Begleiters des Paulus in seinen Missionsarbeiten trägt, ist offensichtlich unecht. Er ist voll von fabulösen Erzählungen, mystischen, allegorischen Auslegungen des Alten Testaments und phantasievollen Einfällen und wird von den Gelehrten allgemein als ohne Autorität betrachtet.“
Als Beispiel für die unvernünftigen und absurden Dinge, die in diesem Brief enthalten sind, wird folgende Passage zitiert:
„Auch sollst du nicht vom Hyänenfleisch essen: das bedeutet wiederum, sei kein Ehebrecher; noch ein Verderber anderer; und warum? Weil diese Kreatur jedes Jahr ihr Geschlecht wechselt und manchmal männlich und manchmal weiblich ist.“
Somit wird uns, selbst von den Historikern des ersten Tages, gestattet, diesen Brief als Fälschung zu betrachten. Und wer das neunte Kapitel dieses Briefes liest – denn es ist nicht würdig, zitiert zu werden – wird die Berechtigung dieser Schlussfolgerung anerkennen. Dieser Brief ist das einzige Schriftstück, das vorgibt, aus dem ersten Jahrhundert zu stammen, mit Ausnahme des Neuen Testaments, in dem der erste Tag überhaupt erwähnt wird. Dass dies keine Unterstützung für die Sonntagsfeier bietet, räumt selbst Mosheim ein.
Das nächste Dokument, das unsere Aufmerksamkeit verdient, ist der Brief von Plinius, dem römischen Statthalter von Bithynien, an Kaiser Trajan. Es wurde etwa im Jahr 104 n. Chr. geschrieben. Er sagt über die Christen seiner Provinz:
„Sie behaupteten, dass ihr gesamtes Vergehen oder Irrtum darin bestand, dass sie sich an einem bestimmten festgesetzten Tag vor Tagesanbruch versammelten und sich in einer Form des Gebets an Christus als an einen Gott wandten, sich durch einen feierlichen Eid verpflichteten, nicht für böse Zwecke, sondern niemals Betrug, Diebstahl oder Ehebruch zu begehen; niemals ihr Wort zu brechen oder ein ihnen anvertrautes Gut zu verleugnen, wenn sie aufgefordert würden, es herauszugeben; danach war es ihre Gewohnheit, sich zu trennen und dann wieder zusammenzukommen, um gemeinsam eine harmlose Mahlzeit einzunehmen.“
Dieser Brief von Plinius liefert sicherlich keinen Beweis für die Sonntagsfeier. Der Fall wird von Coleman offen dargestellt. Er sagt über diesen Auszug:
„Diese Aussage ist ein Beweis dafür, dass diese Christen einen Tag als heilige Zeit hielten, aber ob es der letzte oder der erste Tag der Woche war, wird nicht deutlich.“
Charles Buck, ein bedeutender Schriftsteller des ersten Tages, sah in diesem Brief keinen Beweis für die Sonntagsfeier, wie aus der unbestimmten Übersetzung hervorgeht, die er gibt. So zitiert er den Brief:
„Diese Personen erklären, dass ihre gesamte Schuld, falls sie schuldig sind, darin besteht: dass sie an bestimmten Tagen vor Sonnenaufgang zusammenkommen, um abwechselnd die Lobpreisungen Christi als eines Gottes zu singen.“
Tertullian, der 200 n. Chr. schrieb, spricht so über diese Aussage von Plinius:
„Er fand in ihren religiösen Diensten nichts anderes als Treffen am frühen Morgen, um Hymnen an Christus und Gott zu singen und ihren Lebensweg durch ein gemeinsames Gelübde zu bekräftigen, ihrer Religion treu zu bleiben, Mord, Ehebruch, Unehrlichkeit und andere Verbrechen zu verbieten.“
Tertullian fand in diesem Brief sicherlich keinen Bezug auf das Fest des Sonntags.
Herr W. B. Tayler spricht über diesen bestimmten Tag wie folgt:
„Da der Sabbattag zu dieser Zeit ebenso häufig beachtet wurde wie der Sonnentag (wenn nicht sogar häufiger), ist es ebenso wahrscheinlich, dass dieser ‚festgesetzte Tag‘, auf den sich Plinius bezieht, der siebte Tag war, wie dass es der erste Tag war, obwohl Letzteres allgemein angenommen wird.“
Das Selbstverständnis des Punktes, der eigentlich bewiesen werden sollte, ist kein neues Merkmal in den bisher untersuchten Beweisen zur Unterstützung der Sonntagsfeier. Obwohl Mosheim auf diesen Ausdruck von Plinius als Hauptstütze des Sonntags setzt, spricht er doch so über die Meinung eines anderen Gelehrten:
„B. Just. Hen. Boehmer wollte uns tatsächlich dazu bringen zu verstehen, dass dieser Tag derselbe war wie der jüdische Sabbat.“
Dieses Zeugnis von Plinius wurde einige Jahre nach der Zeit der Apostel geschrieben. Es bezieht sich auf eine Kirche, die wahrscheinlich vom Apostel Petrus gegründet wurde. Es ist sicherlich viel wahrscheinlicher, dass diese Kirche, nur vierzig Jahre nach dem Tod von Petrus, das vierte Gebot hielt, als dass sie einen Tag hielt, der niemals von göttlicher Autorität befohlen wurde. Es muss eingeräumt werden, dass dieses Zeugnis von Plinius nichts zur Unterstützung der Sonntagsfeier beweist; denn es wird nicht angegeben, welcher Tag der Woche so beachtet wurde.
Die Briefe von Ignatius von Antiochien, die so oft zur Unterstützung der Sonntagsfeier zitiert werden, verdienen als nächstes unsere Aufmerksamkeit. Es wird behauptet, dass er sagte:
„Wenn also diejenigen, die in diesen alten Gesetzen erzogen wurden, dennoch zur Neuheit der Hoffnung kamen; den Sabbat nicht mehr beachtend, sondern den Tag des Herrn haltend, an dem auch unser Leben durch ihn aufging und durch seinen Tod, den einige dennoch leugnen (durch dieses Geheimnis wurden wir zum Glauben gebracht und warten daher, dass wir als Jünger Jesu Christi, unseres einzigen Meisters, gefunden werden): wie sollen wir fähig sein, anders zu leben als er; dessen Jünger selbst die Propheten waren, die durch den Geist ihn als ihren Meister erwarteten.“
Zwei wichtige Fakten im Zusammenhang mit diesem Zitat verdienen besondere Beachtung: 1. Die Briefe des Ignatius werden von Autoren des ersten Tages mit hoher Autorität als unecht anerkannt; und die Briefe, die einige von ihnen als möglicherweise echt betrachten, schließen den Brief an die Magnesier, aus dem das obige Zitat stammt, nicht ein, noch sagen sie etwas über die Sonntagsfeier. 2. Dass der Brief an die Magnesier nichts über irgendeinen Tag sagen würde, wenn das Wort „Tag“ nicht betrügerisch vom Übersetzer eingefügt worden wäre! Zur Unterstützung der ersten dieser Thesen wird folgendes Zeugnis vorgelegt. Dr. Killen spricht folgendermaßen:
„Im sechzehnten Jahrhundert wurden fünfzehn Briefe aus dem Mantel eines hoary antiquity hervorgeholt und der Welt als die Werke des Pastors von Antiochien angeboten. Gelehrte weigerten sich, sie zu den geforderten Bedingungen zu akzeptieren, und sofort wurden acht von ihnen als Fälschungen anerkannt. Im siebzehnten Jahrhundert tauchten die verbleibenden sieben Briefe, in einer etwas veränderten Form, wieder aus der Dunkelheit auf und behaupteten, die Werke von Ignatius zu sein. Wieder lehnten es kritische Geister ab, ihre Ansprüche anzuerkennen; aber die Neugier war geweckt und viele drückten den ernsthaften Wunsch aus, einen Blick auf die echten Briefe zu werfen. Griechenland, Syrien, Palästina und Ägypten wurden durchforstet, um sie zu finden, und schließlich wurden drei Briefe gefunden. Die Entdeckung löste allgemeine Freude aus; es wurde zugegeben, dass vier der Briefe, die soeben als echt behauptet worden waren, apokryphisch waren; und es wird kühn gesagt, dass die drei jetzt vorliegenden Briefe über jeden Zweifel erhaben sind. Aber die Wahrheit weigert sich weiterhin, sich zu kompromittieren, und verweigert diesen Bewerbern streng ihre Anerkennung. Die internen Beweise dieser drei Briefe bestätigen reichlich, dass sie, wie die letzten drei Bücher der Sibylle, nur die letzten Züge eines schweren Betrugs sind.“
Der gleiche Schriftsteller gibt die Meinung Calvins folgendermaßen wieder:
„Es ist kein geringes Zeugnis für die Weisheit des großen Calvin, dass er vor mehr als dreihundert Jahren ein vernichtendes Urteil über diese Ignatius-Briefe gefällt hat.“
Von den drei Briefen von Ignatius, die immer noch als echt beansprucht werden, spricht Prof. C. F. Hudson folgendermaßen:
„Ignatius von Antiochien wurde wahrscheinlich 115 n. Chr. gemartert. Von den acht Briefen, die ihm zugeschrieben werden, sind drei echt; nämlich die an Polykarp, die Epheser und die Römer gerichteten.“
Es wird bemerkt, dass die drei Briefe, die hier als echt genannt werden, den Brief, aus dem das Zitat zur Unterstützung des Sonntags entnommen ist, nicht einschließen, und es ist auch ein Faktum, dass sie keinen Hinweis auf den Sonntag enthalten. Sir Wm. Domville, ein anti-sabbatärer Schriftsteller, verwendet folgende Sprache:
„Jeder, der in solchen Angelegenheiten einigermaßen bewandert ist, weiß, dass die Werke von Ignatius mehr interpoliert und korrumpiert wurden als die irgendeines anderen der alten Kirchenväter; und auch, dass ihm einige Schriften zugeschrieben wurden, die völlig unecht sind.“
Robinson, ein bedeutender englischer baptistischer Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, äußert die folgende Meinung über die Briefe, die Ignatius, Barnabas und anderen zugeschrieben werden:
„Wenn irgendeines der Schriften, die jenen zugeschrieben werden, die als apostolische Väter bezeichnet werden, wie Ignatius, Lehrer in Antiochien, Polykarp in Smyrna, Barnabas, der ein halber Jude war, und Hermas, der Bruder von Pius war, Lehrer in Rom, wenn irgendeines dieser Schriften echt ist, woran es große Zweifel gibt, beweisen sie nur die Frömmigkeit und Unbildung der guten Männer. Einige sind schlechter und die besten nicht besser als die frommen Briefe der niederen Schicht der Baptisten und Quäker zur Zeit des Bürgerkriegs in England. Barnabas und Hermas erwähnen beide die Taufe; aber beide diese Bücher sind verachtenswerte Schwärmereien wilder und unregelmäßiger Geister.“
Der zweifelhafte Charakter dieser Ignatius-Briefe ist damit hinreichend belegt. Das Zitat zur Unterstützung des Sonntags ist nicht aus einem der drei Briefe entnommen, die noch als echt beansprucht werden; und was noch weiter zu beachten ist, es würde nichts in Bezug auf irgendeinen Tag sagen, wenn nicht ein außerordentlicher Freiraum, nicht zu sagen Betrug, vom Übersetzer genutzt worden wäre, um das Wort „Tag“ in das Dokument einzufügen. Diese Tatsache wird von Kitto, dessen Enzyklopädie bei Gelehrten des ersten Tages hoch angesehen ist, mit kritischer Genauigkeit dargestellt. So stellt er das Original von Ignatius mit Kommentaren und einer Übersetzung wie folgt vor:
„Wir müssen hier eine weitere Passage bemerken … die sich auf das Thema des Herrentages bezieht, obwohl sie sicherlich keine Erwähnung davon enthält. Sie kommt im Brief von Ignatius an die Magnesier (um das Jahr 100 n. Chr.) vor. Die ganze Passage ist zweifellos obskur, und der Text könnte korrupt sein…. Die Passage lautet wie folgt:
„Ei oun oi en palaiois pragmasin anastraphentes eis kainoteta elpidos elthon-meketi sabbatixontes, alla kata kuriaken xoen xontes-(en e kai e xoe emon aneteilen oi autou, etc.)
„Nun nehmen viele Kommentatoren an (auf welcher Grundlage, erscheint nicht), dass nach kuriaken [Herrentag] das Wort emeran [Tag] verstanden werden muss…. Lassen wir uns nun die Passage einfach so ansehen, wie sie steht. Der Mangel des Satzes besteht im Fehlen eines Substantivs, auf das sich autou beziehen kann. Dieser Mangel wird, anstatt behoben zu werden, durch die Einführung des Wortes emera noch deutlicher. Wenn wir kuriake xon jedoch einfach als ‚das Leben des Herrn‘ nehmen, das eine eher persönliche Bedeutung hat, geht es sicherlich eher dahin, das Substantiv für autou zu liefern…. Somit könnte die Bedeutung folgendermaßen gegeben werden:
„Wenn also diejenigen, die unter der alten Disposition gelebt haben, zur Neuheit der Hoffnung gekommen sind, den Sabbat nicht mehr beachten, sondern nach dem Leben des Herrn leben (in dem unser Leben durch ihn auferstanden ist, etc.)….
„In dieser Sichtweise bezieht sich die Passage überhaupt nicht auf den Herrentag; aber selbst bei der gegenteiligen Annahme kann sie nicht als positiver Beweis für die frühe Verwendung des Begriffs ‚Herrentag‘ angesehen werden (wofür sie oft zitiert wird), da das wesentliche Wort emera [Tag] rein spekulativ ist.“
Der gelehrte Morer, ein Geistlicher der Kirche von England, bestätigt diese Aussage von Kitto. Er übersetzt Ignatius so:
„Wenn also diejenigen, die in den Werken alter Tage erfahren waren, zur Neuheit der Hoffnung kamen, den Sabbat nicht mehr beachtend, sondern nach dem Leben des Herrn lebend, etc…. Die Mediceische Ausgabe, die beste und derjenigen von Eusebius am ähnlichsten, lässt keinen Zweifel, weil xoen ausgedrückt wird und das Wort dominikal auf die Person Christi und nicht auf den Tag seiner Auferstehung bezieht.“
Sir Wm. Domville spricht zu diesem Punkt wie folgt:
„Urteilt man daher nach dem Tenor des Briefes selbst, scheint die wörtliche Übersetzung der fraglichen Passage, ‚den Sabbat nicht mehr beachtend, sondern nach dem Leben des Herrn lebend‘, ihre wahre und richtige Bedeutung zu geben; und wenn dies so ist, versagt Ignatius, den Herr Gurney als wesentlichen Zeugen anführt, um die Beachtung des Herrentages zu Beginn des zweiten Jahrhunderts zu beweisen, darin, irgendeine solche Tatsache zu beweisen, da sich bei einer gründlichen Untersuchung seines Zeugnisses herausstellt, dass er den Herrentag nicht einmal erwähnt, noch in irgendeiner Weise auf dessen religiöse Beachtung hinweist, sei es unter diesem Namen oder unter einem anderen.“
Es ist daher klar, dass dieses berühmte Zitat überhaupt keinen Bezug auf den ersten Tag der Woche hat und dass es keinen Beweis dafür liefert, dass dieser Tag zu Zeiten von Ignatius als Herrentag bekannt war. Das Beweismaterial liegt nun dem Leser vor, das entscheiden muss, ob Moshiem oder Neander in Übereinstimmung mit den Tatsachen im Fall gesprochen hat. Und so erscheint es, dass es im Neuen Testament und in den nicht inspirierten Schriften der betreffenden Zeit absolut nichts gibt, was die starke Sonntagsaussage von Mosheim stützt. Wenn wir zum vierten Jahrhundert kommen, werden wir eine Aussage von ihm finden, die seine hier gemachten Aussagen wesentlich modifiziert. Von den Briefen, die Barnabas, Plinius und Ignatius zugeschrieben werden, haben wir festgestellt, dass der erste eine Fälschung ist; dass der zweite von einem festgesetzten Tag spricht, ohne zu definieren, welcher es war; und dass der dritte, der wahrscheinlich ein unechtes Dokument ist, nichts über den Sonntag sagen würde, wenn die Verfechter der Heiligkeit des ersten Tages nicht das Wort „Tag“ in das Dokument interpoliert hätten! Wir können kaum umhin, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Mosheim in dieser Angelegenheit eher als Doktor der Theologie sprach und nicht als Historiker; und mit der festesten Überzeugung, dass wir die Wahrheit sagen, stimmen wir mit Neander überein: „Das Fest des Sonntags war immer nur eine menschliche Verordnung.“